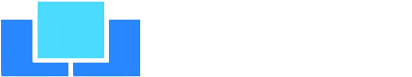Werte und Normen
Fachgruppe Werte und Normen

von links nach rechts:
Laura Wyludda, Armin Schäfers (Fachgruppenleitung), Bianca Rudolf (stellvertretende Fachgruppenleitung), Thorven Lucht, Hazel Lucht, Juliane Diga-Liste, Isabelle Bode
Bildungsbeitrag
Das Fach Werte und Normen wird am Humboldt-Gymnasium ab der Jahrgangsstufe 5 unterrichtet und steht allen Schülerinnen und Schülern des Humboldt-Gymnasiums offen. Es behandelt Fragen nach dem Ich, nach der Zukunft, nach Moral und Ethik, nach der Wirklichkeit und nach Orientierungsmöglichkeiten. Dabei bezieht es sich in erster Linie auf philosophische, religionswissenschaftliche und gesellschaftswissenschaftliche Problemstellungen.
Argumentationsgrundlage und Orientierungsrahmen des Faches sind die Prinzipien des demokratischen und sozialen Rechtsstaates und die Grund- und Menschenrechte. Ein zentrales Anliegen des Faches ist es, die Lernenden vertraut zu machen mit dem Menschenbild der Aufklärung und der im Grundgesetz zum Ausdruck gebrachten Überzeugung, dass der Mensch eine spezifische Würde besitzt. Auf dieser Grundlage werden unterschiedliche Weltanschauungen und Wahrheitsauffassungen im Sinne einer prinzipiellen Pluralität berücksichtigt.
Ziel des Unterrichtes ist es, die Lernenden dazu zu befähigen, eine eigenständige ethische Urteilsfähigkeit zu entwickeln, die es ihnen ermöglicht, Verantwortung im privaten und gesellschaftlichen Bereich zu übernehmen. Durch die Beschäftigung mit lebensnahen Themen leistet das Fach ebenso einen Beitrag zur Identitätsentwicklung der Kinder und Jugendlichen.
Themen
In inhaltsbezogener Perspektive wird der Unterricht im Fach Werte und Normen durch folgende Themen strukturiert:
- Doppelschuljahrgang 5/6:
• Ich und meine Beziehungen
• Glück und Lebensgestaltung
• Regeln für das Zusammenleben
• Leben in Vielfalt
• Aspekte von Religionen und Weltanschauungen
- Doppelschuljahrgang 7/8:
• Das Ich und seine sozialen Rollen
• Konstruktiver Umgang mit Krisen
• Liebe und Sexualität
• Menschenrechte und Menschenwürde
• Leben in religiös und weltanschaulich geprägten Kulturen
- Doppelschuljahrgang 9/10:
• Entwicklung und Gestaltung von Identität
• Verantwortung für Natur und Umwelt
• Ethische Grundlagen für Konfliktlösungen
• Wahrheit und Wirklichkeit
• Deutungsmöglichkeiten und -grenzen von Religionen und Weltanschauungen
- Schuljahrgang 11:
• Individuum und Gesellschaft
• Religionen und Weltanschauungen
- Schuljahrgang 12:
• Anthropologie
• Ethik
- Schuljahrgang 13:
• Wahrheit und Wirklichkeit
• Lebensentwürfe
Arbeitsweise
Die Arbeitsweisen des Werte und Normen Unterrichts sind so vielfältig wie seine Themen. Es werden grundlegende Kompetenzen vermittelt wie genaue Textarbeit, die mündliche und schriftliche Stellungnahme und angemessenes und tolerantes Verhalten in Diskussionen. Daneben bietet aber gerade der Werte und Normen Unterrichtet die Möglichkeit, sich kreativ mit den Themen zu beschäftigen: Perspektivübernahmen in Form von Rollenspielen oder Schreibaufträgen (innerer Monolog, Tagebucheintrag etc.), Plakat- und Bildgestaltungen sowie Präsentationen kommen im Unterricht vielfältig zum Einsatz.
In prozessbezogener Perspektive wird der Unterricht im Fach Werte und Normen durch folgende Fähigkeiten und Fertigkeiten strukturiert:
- Wahrnehmen und Beschreiben
- Verstehen und Reflektieren
- Diskutieren und Urteilen
Näher ausgeführt werden die curricularen Vorgaben zu Themen und Arbeitsweisen in den beiden Kerncurricula:
Wochenstundenzahl und Abitur
Der Unterricht im Fach Werte und Normen wird in jedem Jahrgang der Sekundarstufe I und im Jahrgang 11 in zwei Unterrichtsstunden pro Woche erteilt. In den Jahrgängen 12 und 13 wird das Fach Werte und Normen in drei Unterrichtsstunden pro Woche unterrichtet.
Werte und Normen kann auf grundlegendem Anforderungsniveau („Grundkurs“, P4/P5) als Prüfungsfach ins Abitur eingebracht werden.
Leistungsbewertung
Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht erworbenen Kompetenzen. Es wird die Mitarbeit im Unterricht und die Leistung in schriftlichen Arbeiten beurteilt. Die Mitarbeit im Unterricht geht zu 60% und die schriftliche Leistung zu 40% in die Gesamtnote ein.
In jedem Schulhalbjahr wird eine schriftliche Arbeit geschrieben. Hier werden überwiegend Kompetenzen und Inhalte überprüft, die innerhalb einer Unterrichtseinheit in einem überschaubaren Rahmen erworben wurden. Die Dauer einer schriftlichen Arbeit beträgt in der Regel in der Sekundarstufe I eine Schulstunde und in der Sekundarstufe II zwei Schulstunden.
Zur Mitarbeit im Unterricht zählen eine Vielzahl von Aspekten:
- Beiträge zum Unterrichtsgespräch
- Mündliche Überprüfungen
- Unterrichtsdokumentationen (Mappe, Protokoll, Lerntagebuch...)
- Anwenden fachspezifischer Methoden und Arbeitsweisen
- Präsentationen, auch mediengestützt
- Ergebnisse von Partner- und Gruppenarbeiten und deren Darstellung
- Planung und Durchführung von Wettbewerben
- …
Exkursionen
Das Fach Werte und Normen ermöglicht eine Vertiefung der behandelten Themen auch an außerschulischen Lernorten. Das konkrete Exkursionskonzept befindet sich gegenwärtig in Überarbeitung.